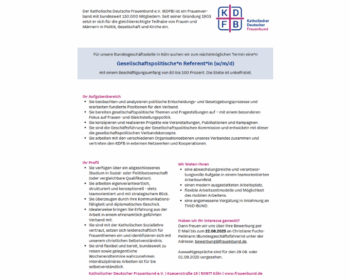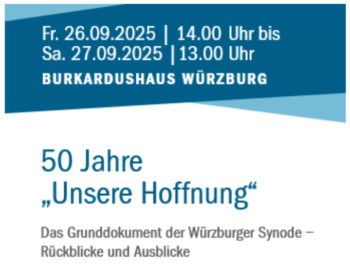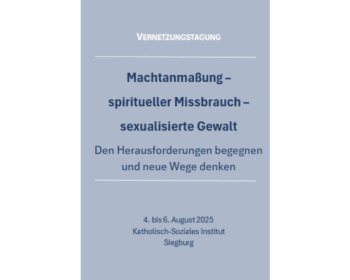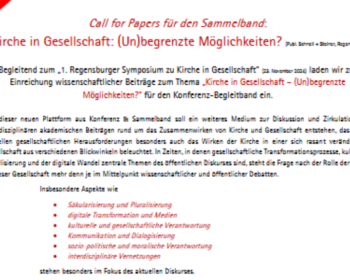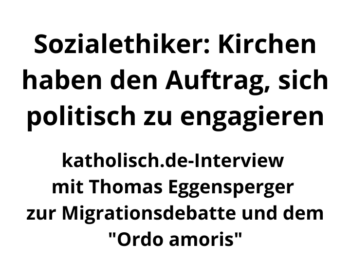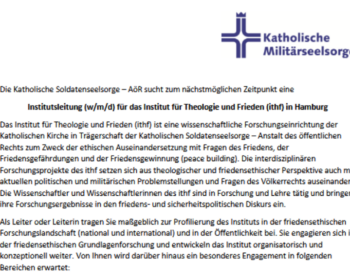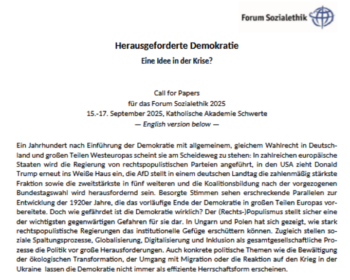Neuerscheinung: Ethik und Gesellschaft (1/2025) – Praktiken und Institutionen der Solidarität

Im vergangenen Mai ist die neueste Ausgabe von Ethik und Gesellschaft (1/2025) erschienen. Sie trägt den Titel „Praktiken und Institutionen der Solidarität. Sozialethische und politisch-theologische Perspektiven“. Das online frei zugängliche Heft knüpft an zeitgenössische Debatten an, die den umstrittenen, umkämpften, ambivalenten Charakter von Solidarität betonen: Wie weit reicht Solidarität angesichts der fortschreitenden Zerstörung der planetaren Lebensgrundlagen? Wen schließt sie unter dem Eindruck fortdauernder kolonialer und patriarchaler Verhältnisse ein und wen aus? Von wem werden welche solidarischen Anstrengungen verlangt – zu wessen Vorteil? Wer hat Zugang zu solidarischen Institutionen, soll diese stützen und profitiert von ihnen? Inwiefern werden also Solidarisierungen von Desolidarisierungen begleitet und handelt es sich dabei um unumgängliche Prozesse? Entgegen einer offenbar vorhandenen intuitiven Plausibilität in gesellschaftlichen Zusammenhängen bedarf der Begriff der Solidarität heute einer Konturierung, die sich auch anderen als den bekannten Formen und Strukturen der Solidarität zuwendet. Somit legt sich nahe, vor allem das Verhältnis von Praktiken und Institutionen der Solidarität zu fokussieren und dabei mit einer besonderen Sensibilität für Kontexte, In-/Exklusionen und soziale (Macht-)Verhältnisse vorzugehen. Ein gegenwartstaugliches Verständnis von Solidarität lässt sich nur über eine Vielfalt an Perspektiven und Kontexten sowie im Verhältnis zu anderen Schlüsselbegriffen und Grundkategorien erarbeiten. Die Diskussion knüpft dabei an eine lange Tradition der Auseinandersetzung mit dem Solidaritätsthema in politischen Theologien und in der Christlichen Sozialethik an. Diese gilt es, vor dem Hintergrund der aktuellen Krisenlagen fortzuschreiben, zu aktualisieren oder auch neu zu justieren. Dazu möchte die Ausgabe einen Beitrag leisten. Im Rezensionsteil geht es – vor dem Hintergrund des Ukraine-Kriegs – um Perspektiven theologischer Friedensethik. Es geht aber auch um theologische Rassismuskritik in den USA (Niebuhr), um die Gottesfrage in einer Welt der Gewalt und nicht zuletzt auch um die Gefahren einer mangelnden Resistenz von Kirche und Christentum ›gegen rechts‹. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf dem Selbstverständnis heutiger Arbeitssoziologie, der Frage nach Eigentumsrechten der Natur, nach alten und neuen Definitionen von ›Wohlstand‹ und nach dem Stellenwert von Kinderrechten in der Corona-Pandemie. Zudem finden sich Rezensionen zu den neuen Büchern von Judith Butler, Onur Erdur, Rahel Jaeggi und Daniel Loick. Hinzu kommen schließlich Besprechungen zu einem Sammelband über das Spätwerk von Jürgen Habermas – und zu einer Promotion, die sich mit der Frage beschäftigt, ob man mit Hannah Arendt und Theodor W. Adorno ›die Welt verändern‹ kann. Zur Website von Ethik und Gesellschaft.